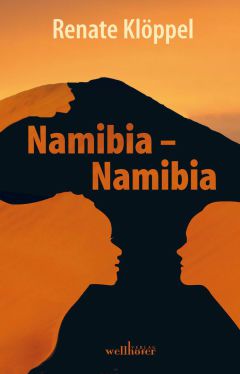Leseprobe 1. Kapitel
Jenseits der Altstadt, dort wo Herdern liegen musste, flackerte der Nachthimmel in einem schmutzigen Rot, und die tiefhängenden Regenwolken schoben sich wie von roten Scheinwerfern angestrahlt auf den Schlossberg zu. Weiter im Osten, wo der Schwarzwald begann, löste das grelle Licht eines Blitzes eine bewaldete Kuppe aus der Finsternis. Gleich darauf verschwand die blau flackernde Anhöhe wieder, die roten Wolken blieben.
Als Alexander Kilian an der Schwabentorbrücke in den Schlossbergring einbog, verdeckte der Berg das gespenstische Schauspiel. Er drehte das Radio lauter. Seit Tagen hatte er keine Nachrichten gehört. Während der Konferenz in Dresden hatte ein kleines und den Normalsterblichen weitgehend unbekanntes Lebewesen namens Zebrafisch sein Denken beherrscht, und er war gemeinsam mit über sechshundert Wissenschaftlern und Technikern aus aller Welt von einer Veranstaltung zur nächsten geeilt. Was außerhalb der Stadt geschah, war unbemerkt an ihm vorbeigegangen. Den Flug von Dresden nach Stuttgart hatte er verschlafen.
Als er vor seiner Haustür aus dem Wagen stieg, hatte er den roten Himmel längst vergessen. Der Gewitterregen war weitergezogen, aber die Nässe hing noch wie warmer Atem zwischen den Häusern. Alexander nahm den kleinen Lederkoffer vom Rücksitz und schlug die Autotür zu. Nicht zum ersten Mal überfiel ihn bei der Rückkehr nach einer Reise plötzlich die Furcht, während seiner Abwesenheit könne sich ein Unglück ereignet haben, von dem er nichts wusste. Er atmete tief durch die Nase ein. Was da in der Luft hing, war nicht der Rauch eines Holzfeuers oder der Geruch von angebrannten Grillwürsten, es war der beißende Qualm eines zerstörerischen Brandes. Prüfend sah er zu seiner Wohnung empor, bis er sich sicher war: Die stinkenden Schwaden stammten nicht aus diesem Haus. Wieder mal hatte sich seine Befürchtung nicht bestätigt.
In der Ferne hörte er ein Martinshorn. Es kam näher, war plötzlich direkt hinter ihm. Mit flackerndem Blaulicht und heulendem Martinshorn jagte ein Polizeifahrzeug durch die stille Mozartstraße, vorbei an ein paar Menschen am Straßenrand. Den Blick hatten sie in eine Ferne gerichtet, die er von seinem Haus aus nicht sehen konnte. Zögernd setzte sich die Gruppe in die Richtung in Bewegung, in der das Polizeifahrzeug verschwunden war.
Alexander stellte seinen Koffer in den Wagen zurück. Sekunden kämpfte er mit sich selbst, dann folgte er langsam und unschlüssig dem Grüppchen, ehe er seinen Schritt beschleunigte und die anderen überholte.
Die Nässe verschleierte grau und gespenstisch die Konturen der Häuser und Bäume, aber ein paar Steinwürfe entfernt zuckten blaue Lichter in der Finsternis. Alexander ging noch schneller, lief schließlich auf das Schauspiel zu. Das ungute Gefühl hatte sich längst wieder eingestellt, nach weiteren hundert Metern war daraus eine Gewissheit geworden. Noch ein paar Meter, dann erstarrte er.
Er schloss die Augen. Am liebsten hätte er sie gar nicht wieder geöffnet, als könnte er die Katastrophe ungeschehen machen, indem er sie nicht zur Kenntnis nahm. Das träume ich nur, redete er sich ein, das ist nicht die Wirklichkeit. Ich muss nur aufwachen, dann ist alles wie immer.
Er riss die Augen auf.
Nichts war wie immer.
Fünfzig Meter von ihm entfernt standen rot-weiße Kegel auf der Straße. Der Fußweg war mit einem flatternden Band gesperrt – die Grenze zwischen Gaffern und Rettern. Wenn es denn noch etwas zu retten gab! Hinter der Grenze stand auf der rechten Straßenseite eine große Villa aus der Gründerzeit, ein hohes Haupthaus, an das sich beiderseits zwei schiefergedeckte Seitenflügel anschlossen. Man sah ihm nicht an, dass die letzte Renovierung erst zehn Jahre zurücklag. Die Nässe unter den alten Kastanien hatte dem Mauerwerk zugesetzt, die filigrane Steinbrüstung des Balkons in der Mitte des Haupthauses war mit den Jahren schwarz geworden, und von den geschwungenen und verzierten Konsolen und den Stuckquadern der Hauswand blätterte die Farbe. Das Gebäude beherbergte sein Institut.
Er hatte das alte Haus in der Nähe des Stadtgartens abseits des Institutsviertels vom ersten Tag an geliebt und als sein zweites Zuhause betrachtet. Nun züngelten aus dem Dach des Südflügels kleine rote Flammen. Harmlos anzusehen war das, aber er hatte die schlimme Ahnung, dass dies die Vorhut eines Feuersturms war, der nur noch auf das Kommando zum Ausbruch wartete. Auf der Stirnseite loderten die Flammen meterhoch. Zwei Fenster im Obergeschoss waren geborsten. Prasselnd und fauchend verschlang das Feuer, was sich dahinter befunden hatte. Die Fenster gehörten zu Frau Brändles Zimmer. Brändle wie brennen. Er verfluchte den Tag, als ihm der Satz zum ersten Mal in den Sinn gekommen war. Mit diesem Gedanken über seine Sekretärin musste er das Feuer geradezu angelockt haben!
Neben den beiden Fenstern des Sekretariats zersplitterte mit lautem Knall die nächste Scheibe, und in einem Funkenregen loderten die Flammen in den nächtlichen Himmel. Es war ein Fenster seines Arbeitszimmers.
Alexander schlug die Hände vor sein Gesicht. Alles, was er in seinem Leben geleistet hatte, ging dort in Flammen auf. Sein Lebenswerk brannte wie Zunder: die Zeitschriften mit seinen wissenschaftlichen Arbeiten, die Urkunden über Ehrungen und Wissenschaftspreise, die er in langen Jahren zusammengetragen hatte. Was blieb davon? Nichts als Asche!
Er drängte sich zwischen den Gaffern hindurch bis zur Absperrung. Vor dem brennenden Institut standen sechs oder sieben Feuerwehrautos: Fahrzeuge mit Drehleitern, Löschfahrzeuge mit Schläuchen, ein Einsatzleitwagen. Für einen winzigen Augenblick dachte er, dass seine kleine Corinna bei dem Anblick leuchtende Augen bekommen hätte. Ihm hingegen war zum Heulen zumute. Er starrte auf die Männer in Uniform, zuckende Akteure, deren neonfarbene Reflexstreifen sich im Blaulicht ruckartig bewegten wie die Glieder von Tänzern in einem modernen Ballett. Mit den Helmen sahen die Köpfe der Tänzer wie fahl-gelb fluoreszierende Kugeln aus. Die Männer rannten hin und her, brüllten Kommandos, zerrten Schläuche durch die Eingangstür, verschwanden mit Atemmasken und Pressluftflaschen im Haus. Nur eines taten sie nicht: löschen! Zumindest sah er nichts davon. Interessierte es denn niemanden, dass hier sein ganzes Leben in Flammen aufging?
Wenigstens aus einem einzigen Schlauch könnte doch endlich Wasser kommen! Es dauerte eine Ewigkeit , bis endlich eine Drehleiter vor den Fenstern ausgefahren war und ein armdicker Wasserstrahl ins Feuer schoss. Eine Ewigkeit! So kam es ihm jedenfalls vor.
Dann ein zweiter Strahl, ein dritter. Wassermassen ergossen sich durch die geborstenen Fenster und auf das brennende Dach, flossen von dort in Sturzbächen am Gebäude herunter, überschwemmten die Straße. Das ganze Haus musste gleich in den Fluten versinken. Was das Feuer übrigließ, zerstörte das Wasser. Ohnmächtig sah Alexander der Vernichtung zu.
------
Vom Münsterturm schlug es Mitternacht, als Alexander zu seiner Wohnung zurückging. Geisterstunde, dachte er, als er die Glocke hörte, und gab sich schwarzen Gedanken hin.
Doch das, was vor seiner Haustür lag, war weiß. Leuchtend weiß, wie ein kleines Fleckchen Schnee. Ein Taschentuch? Schon ehe er sich bückte, wusste er, dass es keine harmlose Erklärung für dieses kleine bisschen Weiß vor seiner Wohnung geben würde. Er berührte den weißen Fleck und fuhr zurück. Sein Herz schlug schneller. Nein, das war kein Papier, es war viel weicher und glatter. Etwas Haariges? Ein totes Tier? Er schaltete das Licht an.
Auf dem Abtreter lag eine tote Ratte. Keine graue, wie sie hundertausendfach in Freiburg hausten. Nein, es war eine weiße Ratte. Eine graue Ratte hätte ihn weniger erschreckt. Die nächste Falle mit Giftködern stand im Stadtgarten nicht weit von seiner Wohnung entfernt. Er erwartete schon lange, eines Tages auf eine vergiftete Ratte zu stoßen. Irgendwo mussten die armen Tiere schließlich ihr Leben beenden. Aber diese Ratte war weiß.
Eine Weile betrachtete er unentschlossen das ungewöhnliche Exemplar, dann entschied er, ihm nicht mehr Aufmerksamkeit zu schenken, als er es bei einem grauen getan hätte. Der Brand allein war schlimm genug. Er hob das Tier an der Schwanzspitze hoch und versenkte es in der Mülltonne.
Ein Unglück kommt selten allein, dachte er, als er die Tür aufschloss, und im nächsten Augenblick überkam ihn die Gewissheit, dass sich das nächste bereits ereignet hatte. Die Wohnung roch, wie sie nicht riechen sollte. Unangenehm wäre für das, was ihm entgegenschlug, stark untertrieben. Die Wohnung stank widerlich. Leichengeruch? Den hatte er glücklicherweise nur ein einziges Mal in seinem Leben so intensiv wahrgenommen, und das lag lange zurück. Dreißig Jahre? Damals war er Medizinstudent gewesen und hatte eine Leichenöffnung in der Rechtsmedizin ertragen müssen. Der Tote damals war erst viele Tage nach seinem Ableben in einem von der Sonne beschienenen Bauwagen gefunden worden. Genauso wie der Tote damals roch es jetzt in seiner Wohnung.
Und nun? Die Polizei anrufen? Alles in ihm wehrte sich dagegen, der nächsten Katastrophe ins Auge zu sehen, noch dazu allein. Doch er hatte keine andere Wahl.
Schritt für Schritt bewegte er sich in den Flur. Die Haustür hatte er offen gelassen. Als Fluchtweg. Er stieß die Wohnzimmertür so weit auf, dass sie an der Wand anschlug. Dahinter war nichts. Hier war alles in Ordnung, abgesehen von den Rosen in der Vase, die wie eine Ansammlung von Trauernden die Köpfe hängenließen. Er betrat sein Arbeitszimmer. Der Rollladen war geschlossen, das war ungewöhnlich. Hatte seine Putzfrau im Dunkeln geputzt? Nein, sie war diese Woche krank – jetzt erinnerte er sich.
Er kehrte in den Flur zurück und fuhr erschreckt zusammen, als die Schlafzimmertür mit lautem Knall ins Schloss fiel. Mit einem schnellen Schritt erreichte er eine Nische neben der Garderobe, die im Dunkeln lag. Er atmete kaum. Nichts geschah. In der Wohnung war es totenstill, nur durch die offene Wohnungstür hörte er die Blätter der alten Akazie rauschen.
Nach einer Zeit, die ihm endlos erschien, wagte er die Nische zu verlassen. Er öffnete die Schlafzimmertür und knipste das Licht an. Niemand war hier, und auch sonst entdeckte er nichts, was ihn beunruhigte. Er bückte sich trotzdem und sah unter das Bett. Nichts.
Er fand die Leiche in der Küche, zumindest die Teile, die Ina, Corinna und er davon übriggelassen hatte. Sie lag im Mülleimer. Es war ein roher Hasenrücken, von dem Ina vor dem Braten mit gekonnten Bewegungen die Filets gelöst hatte. Den Rest, an dem jetzt dicke weiße Maden fraßen, hatte er selbst im Mülleimer entsorgt. Angeekelt trug er den stinkenden Beutel zur Mülltonne. Morgen kam die Müllabfuhr, aber bis dahin würde die ganze Umgebung nach Verwesung riechen.
Er riss alle Fenster auf und öffnete die Terrassentür. Draußen schaukelte seine altmodische Laterne in der windigen Nacht und warf ein unruhiges Licht in die Finsternis.
Ein Geräusch ließ ihn herumfahren. Im Garten bewegte sich etwas. Was es war, konnte er nicht erkennen, aber er hörte deutlich das Rascheln im Efeu unter den Hainbuchen. Ein Igel? Eine Katze? Vielleicht hatte eine Katze die tote Ratte vor seiner Haustür abgelegt, vielleicht die fette mit dem grau-weißen Fell und dem zu kleinen Kopf? Katzen gab es hier genug. Nur passte das Geräusch nicht zu einer Katze, jedenfalls nicht zu einer auf vier Beinen.
Er hätte jetzt nachsehen können, aber er zögerte. Für heute keine erschreckenden Entdeckungen mehr! Das Maß der zumutbaren Aufregung war nicht nur voll, es war längst übergelaufen. Nein, er hielt die tote Ratte nicht ernsthaft für das Präsent einer Katze.
Halbherzig tat er ein paar Schritte in den Garten, der in völliger Finsternis vor ihm lag, dann kehrte er um und ging zu seinem Auto, um seinen Koffer zu holen. Sorgfältiger als gewöhnlich verschloss er danach alle Fenster und Türen seiner Wohnung. Den Gestank von Verwesung, der immer noch in den Räumen hing, würde er ertragen müssen.
------
Der Brand. Die Ratte. Aber da war noch etwas anderes gewesen, was ihn beunruhigt hatte. Richtig, das Geräusch im Garten. Das war keine Katze gewesen, auch kein Igel.
Es gibt Dinge, die erst Wirklichkeit werden, wenn man sie mit eigenen Augen gesehen hat. Bis dahin bleiben sie eine vage Ahnung. Seit Jahren hatte er trainiert, solche Vermutungen so lange wie möglich nicht in Gewissheit zu verwandeln. Aber jetzt war es soweit. Er wollte wissen, was gestern Abend passiert war.
Als er hinten im Garten stand, von wo er das Geräusch gehört hatte, konnte er der Wahrheit nicht mehr ausweichen. Sie sprang ihm förmlich ins Auge. An dieser Stelle war der rostige Maschendraht nach außen gebogen. Irgendetwas hatte hier den Garten verlassen. Etwas Großes. Ein großes Tier? Wenn der Zaun von einem Tier zerstört worden war, musste es mindestens ein Wildschwein gewesen sein. Oder eine Kuh, aber beide gingen nicht in der Stadt spazieren. Also ein Mensch. Der Mensch, der die Ratte vor der Tür abgelegt hatte?
Alexander fühlte, wie ihm eine Gänsehaut über den Rücken lief. Der Brand, die tote Ratte vor seiner Haustür, ein Mensch, der über den Gartenzaun gestiegen war: der Zusammenhang drängte sich förmlich auf. Andererseits hatte er sich schon oft darüber gewundert, wie seine Mitmenschen Zusammenhänge erkannten, wo keine waren. Zwischen dem zunehmenden Mond und der angeblich gleichzeitig steigenden Zahl der Geburten zum Beispiel. War es jetzt bei ihm selbst schon so weit gekommen?
Der Zaun war wahrscheinlich schon seit Jahren beschädigt, und das Institut war bei einem Gewitter in Brand geraten, also durch Blitzschlag. Er hatte den Blitz doch mit eigenen Augen gesehen!
Das Feuer hat nichts mit mir zu tun. Es hat nichts mit mir zu tun. Wie ein Mantra wiederholte er diesen Satz.
-------
Im ersten Stock des Haupthauses, direkt hinter der Tür zum Treppenhaus, stand zwischen zwei modernen Sesseln ein altes, viel zu niedriges Ledersofa, dessen Bezug mit den Jahren stumpf und rissig geworden war. Auf eben diesem Sofa, umgeben vom beißenden Geruch einer Brandruine, verbrachte Alexander den größten Teil des Vormittags, während die Personen rechts und links auf den Sesseln regelmäßig und nach überwiegend unerfreulichen Gesprächen wechselten. Schließlich erfuhr er, dass im Haus keine Einsturzgefahr bestand und dass sogar der Dachboden über dem Südflügel betreten werden durfte. Dessen Existenz hatte er längst vergessen, aber seine Einsturzgefahr war der Grund für die Wassermassen gewesen, mit der die Feuerwehr von außen den Südflügel hatte fluten müssen.
Nach zwei Stunden stieg Alexander Kilian wieder hinauf zum versiegelten Flur, wo sich bis vor Kurzem sein Arbeitszimmer befunden hatte. Hier hatte sich nichts verändert, nicht einmal Frau Brändle. Reglos stand sie am Fenster des Treppenhauses an derselben Stelle, wo er sie vor einer Stunde verlassen hatte, und sah hinunter auf die Straße: eine Heimatlose in dem Haus, in dem sie den größten Teil der letzten zehn Jahre verbracht hatte. Von der Aufregung, die er erwartet hatte, war nichts zu sehen oder zu hören. Seine Sekretärin hatte sich in einen Stein verwandelt.
Er war eben zum Sofa zurückgekehrt, als ein junger rotgelockter Beamter der Kriminalpolizei auf einem der Sessel neben dem Sofa Platz nahm und ihm mitteilte, dass die Kripo wie auch schon die Feuerwehr momentan von Brandstiftung ausgehe.
„Aber ich habe den Blitz doch mit eigenen Augen gesehen“, widersprach Alexander verzweifelt.
„Blitzschlag kommt nicht in Betracht. Der Feueralarm ging bei der Leitzentrale um einundzwanzig Uhr vierzig ein, zwei Minuten vor dem ersten Blitz in Herdern.“
„Aber so genau kann man das doch gar nicht wissen“, versuchte er es noch einmal, als sei eine erträgliche Brandursache nur eine Frage der richtigen Argumentation.
„Blitzschläge werden genau registriert und die Anrufe in der Feuerwehrleitzentrale ebenfalls.“
„Vielleicht ging eine Uhr falsch.“
„Da ist noch etwas anderes“, sagte der Kommissar, ohne auf den Einwand einzugehen, und Alexander ahnte, dass Brandstiftung noch nicht das Schlimmste war, was er heute würde ertragen müssen. „Kommen Sie mal mit, bitte?“
Gleich hinter der Tür zum Obergeschoss des Südflügels befand sich in der Decke eine Öffnung, die Alexander noch nie aufgefallen war. Jetzt führte eine Leiter nach oben. Von dort aus sah man direkt in den wolkenverhangenen Freiburger Himmel. Früher musste dort das Dach gewesen sein.
Der Beamte stieg hinauf, und Alexander folgte ihm. Hier oben war alles nass und bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Geblieben war Verbogenes, Verkohltes, Verklebtes: eine gespenstische Masse. Sie durchquerten den Dachboden auf einem schmalen Pfad, der notdürftig vom Brandschutt befreit worden war. Ganz am Ende, halb verdeckt unter geborstenen Dachschindeln und den Überresten verkohlter Balken, lag ein formloses schwarzes Bündel auf dem Boden, beinahe so groß wie in Mensch. Alexander schloss die Augen, öffnete sie wieder. Das verkohlte Bündel war einmal ein Mensch gewesen. Er sah an dem verbrannten Körper vorbei und kämpfte gegen den Schwindel, der ihn bei dem Anblick befallen hatte. Zur toten Ratte nun ein grauenvoll verkohlter Mensch – als hätte ihn das Entsetzen noch nicht genügend im Griff.
Rezension:
LESENSWERT
Mit "Blutroter Himmel" liegt seit Februar der sechste Kriminalroman der in Freiburg lebenden Autorin Renate Klöppel vor. Wieder ist Professor Alexander Kilian die Hauptperson und Freiburg Schauplatz der Handlung. Als Kilian von einer Konferenz aus Dresden zurückkommt, steht er am Abend ratlos vor seinem in Flammen stehenden Institut. Danach häufen sich mysteriöse Vorfalle: vor seiner Haustür liegt eine tote weiße Ratte, das Grab seiner Ex-Frau in Karlsruhe wird verwüstet, der Grabstein von radikalen Tierschützern beschmiert und in den Trümmern seines Instituts wird auch noch eine verkohlte Leiche gefunden. Wer ist die junge Frau, die seit Tagen um sein Haus schleicht und warum verhält sich seine langjährige Sekretärin in letzter Zeit so merkwürdig? Passiert das alles wirklich nur, weil er vor Jahren ein paar Labormäuse für seine Experimente benutzt hat? Gemeinsam mit seinem Freund Kommissar Gessler geht der Professor diesen Fragen nach und löst am Ende auch diesen schwierigen Fall, doch wie immer nicht ohne vorher noch einige teilweise *tragimmische Situationen zu überstehen!
Doch bis es soweit ist, bekommt man einen belustigenden Einblick in die Gedankenwelt des etwas verschrobenen Professors, seine Gespräche mit Menschen aus seiner Umwelt, die er aber nur in seinem Kopf führt; sein Sinnieren über Sinn oder Unsinn von Handys oder die Erfindung männergerechter Küchen. Doch auch die wahrhaftig stattfindenden Dialoge sind amüsant zu lesen und tragen dazu bei, das Buch nicht aus der Hand legen zu wollen. Renate Klöppel hat mit "Blutroter Himmel" einen Krimi abgeliefert, der kurzweilig und interessant zu lesen ist, die wissenschaftliche Arbeit des Romanhelden ist nicht zu übertrieben geschildert, so lass das Buch auch für Nichtakademiker gut zu lesen ist. Durch die präzisen Ortsangaben im Roman fühlt sich der Freiburg-kundige Leser bei der Lektüre irgendwie heimisch, er kann die Wege der handelnden Personen nachvollziehen und ist somit gedanklich beim Geschehen dabei. – Alles in allem ist Renate Klöppel einmal mehr ein guter Kriminalroman gelungen.
Carsten
April 2013 in der Zeitschrift FREIeBÜRGER