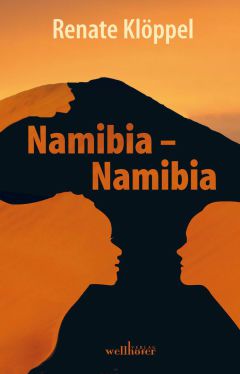Der Pass - Leseprobe
Schwarze, streichholzlange Haare hatte die junge Frau gehabt, die blass und übernächtigt an einem glutheißen Augusttag vor meiner Haustür stand, ein mageres Kind auf dem Arm, blass wie sie, aber lächelnd im Schlaf.
„Kennst du mich nicht mehr?"
Ich erinnere mich nicht, ob sie erschreckt war über meine Bestürzung, meine Verwirrung, meine Fassungslosigkeit. Später dachte ich, vielleicht war sie froh, dass selbst ich sie nicht mehr erkannt hatte, sie, Madeleine, wo wir uns doch erst zwei Monate zuvor begegnet waren, miteinander gesprochen hatten, uns verabredet hatten sogar.
Ich wich zurück, betreten und erschreckt, während sie eintrat in meine Wohnung, ihre Reisetasche abstellte, sich dann umsah und ihr Kind niederlegte, mit Schuhen auf den hellen Bezug aus Segeltuch von meiner Couch.
Ich schloss die Tür hinter uns.
Den Anlass ihres Kommens, diese Ungeheuerlichkeit, erzählte sie wie eine Banalität, als gäbe es nichts, was natürlicher sei.
Einen Wecker hatte sie gekauft.
„Ja und? Was weiter?"
Erinnert hatte er sich an sie. Er, der Verkäufer, hatte sie, die Frau, die den Wecker gekauft hatte, beschreiben können.
„Und? Warum nicht?"
Nur eine Frage der Zeit sei es, bis jemand sie erkenne auf der Phantomzeichnung, die überall in Berlin auf den Polizeiwachen hing.
„Bist du sicher, dass wir nicht abgehört werden?" fragte sie plötzlich.
Ich sah sie verständnislos an.
„Wieso abhören? Hier wird niemand abgehört."
„Verstehst du denn nicht? Der Wecker für die Bombe bei der BVG. Für den Zeitzünder."
„Bombe? BVG?"
„Na, der Anschlag auf die Berliner Verkehrsgesellschaft, auf die Schwarzfahrerkartei."
Plötzlich verstand ich. Tote hatte es nicht gegeben, ich erinnerte mich, auch keine Verletzten. –
Das war es, was sie in Berlin nicht hatte sagen wollen, nicht hatte sagen können: Madeleine war eine Terroristin, eine von denen, die Bomben hochgehen ließen. Die RAF fiel mir ein, der Mord an dem Bankier Jürgen Ponto. Kaum mehr als zwei Wochen waren seither vergangen und der Schock war noch längst nicht überwunden.
Nein, mit der RAF habe sie nichts zu tun, niemals würde sie sich bei denen beteiligen. Deren Strategie sei sowieso grundverkehrt. Es sei viel zu offensichtlich, wer beteiligt sei. Warum sonst säßen die meisten jetzt im Knast? Und Mord sei für sie selbst ohnehin kein Mittel die Gesellschaft zu verändern.
„Wir kämpfen um das Bewusstsein der Menschen, nicht um die Macht."
Und als ich immer noch schwieg:
„Dass man sich wehren muss, wenn man nicht untergehen will, das wirst du doch verstehen!"
---
Der Felsbrocken, groß wie eine Kommode, löste sich ein paar Hundert Meter über uns aus dem Schutt kurz unterhalb der Abbruchkante. Alle sahen ihn. Wir hatten aufgeblickt, als wir das Poltern hörten. Ein riesiger Felsblock zwar, ein heimtückisches Ge schoss, aber weit über uns, also Zeit zum Ausweichen, so dachten wir wohl alle, und wir standen und schauten nach oben, Augenblicke, vielleicht sogar Sekunden, wertvolle Zeit, die wir verstreichen ließen. Und der Klotz, der da auf uns zukam, gewann an Fahrt, raste tiefer. Dann geschah das Unvorhergesehene: der Felsblock zersprang. Die Trümmer, manche fußballgroß, andere wie Wagenräder, meterhoch springend nach jedem Aufschlagen, jagten auf uns zu, unberechenbar wie ein Sternschnuppenschwarm. Im Schutz eines Schuttkegels warf ich mich bäuchlings zu Boden. Dann hörte ich die Schreie derer, die vor mir gingen, sah hilflos, wie die Felsbrocken durch die Rinne sprangen, die die anderen gerade querten, wie riesige, todbringende Ping-Pong-Bälle, sah die vergebliche, blinde Flucht, sah Roswitha fallen, sah Rainer straucheln, von Roswitha zu Boden gerissen, sah ihn den Halt verlieren, dann stürzen vom Weg, der hier keiner mehr war, hinunter zur Schlucht, ohne Schrei, fünf, sechs Meter tief, wo er liegen blieb. Aber Rainer richtete sich wieder auf, vorsichtig im losen Schutt und Geröll.
--------------
An diesem Abend blieb Jan bei mir, als sich die Gruppe trennte. Es wäre absurd gewesen an Liebe zu glauben, auch meinerseits keine Spur davon. Es gab andere Gründe, ihn nicht fortzuschicken. Ich sah es als Zeichen der Anerkennung, dass er mit mir schlief, das erste, seit wir uns begegnet waren. Aber es war nicht einmal dies. Nichts als grausame Berechnung war es, nichts als seine Fähigkeit, mich, uns alle, in eine totale Abhängigkeit zu bringen. Das Mittel war der Wechsel zwischen Verachtung und Zuwendung, zwischen Hohn und Anerkennung und zwischen Vernichtung und Unterstützung. Was mir blieb, als ich dies erkannte, viel später erst, war ein Gefühl der Erniedrigung.
In derselben Nacht, der Nacht zum achtzehnten Oktober, das Ende der Entführung in Mogadischu. Niemand an Bord der „Landshut" hatte die Boeing 707 aus Deutschland bemerkt. Sie landete zwei Kilometer entfernt auf einem entlegenen Teil des Rollfelds. Alle Lichter waren ausgeschaltet. An Bord die Männer der GSG 9. Zwei Stunden brauchten sie, bis die Vorbereitungen abgeschlossen waren. Dann, um 0.05 Uhr, die Detonation der Sprengsätze an den Türen der entführten Maschine, Augenblicke später Blendgranaten, die die Entführer kampfunfähig machten. Sieben Minuten später war das Ganze vorbei. Alle 86 Geiseln unverletzt befreit – ein Wunder –, drei der Entführer tot, die beiden Männer und eine der beiden Frauen. Nur die Libanesin Souhaila Sayeh überlebte schwerverletzt.
Deutschland jubelte.
Acht Stunden später wurden Gudrun Ensslin, Jan Carl Raspe und Andreas Bader tot in ihren Gefängniszellen aufgefunden. Selbstmord, die Männer durch Erschießen, Gudrun Ensslin durch Erhängen, so lautete die offizielle Version. Aber wir glaubten nicht an Selbstmord, wir glaubten an Mord. Nach dem Tod der Gefangenen würde es ein zweites Mogadischu nicht geben.
Hanns Martin Schleyer wurde am nächsten Tag im Kofferraum eines grünen Audi 100 aufgefunden, auch er tot. Dreiundvierzig Tage nach seiner Entführung war er von seinen Bewachern mit drei Kopfschüssen hingerichtet worden.
Fünfundsiebzig Tage nach der Geiselbefreiung, zur selben Uhrzeit, zu der auch die Türen der Lufthansamaschine aus ihren Halterungen gerissen wurden, genau um 0.05 Uhr, starb Madeleine.
Nie wieder danach habe ich meinen Fuß auf Hamburger Boden gesetzt. Ich bin durch die Vororte gefahren, wenn es nicht zu vermeiden war, über die Autobahn von Süden kommend, bei Hamburg-Harburg über die Süderelbe, niemals aber danach über die Elbbrücken in die Stadt hinein sondern im Osten über die Norderelbe, durch Billstedt, dann lag Hamburg schon hinter mir.
Warum ausgerechnet Hamburg, warum gerade die U-Bahn Station Sternschanze?
Vielleicht wäre sonst alles anders gekommen.
Rezension
Die Freiburger Autorin Renate Klöppel schickt ihre Heldin auf eine Trekkingtour in die 68er-Vergangenheit
Als die nicht mehr ganz junge Anne es nach vielen Rückschlägen und Enttäuschungen noch einmal wissen will, wählt sie eine Trekkingtour durch die Bergwelt Nepals. Anne
ist Journalistin, und ihr Lebensweg scheint gekippt, als ihr großer Traum, eine eigene Kulturzeitschrift, mangels Lesern scheitert. Anne will den Annapurna erreichen – auch im übertragenen Sinn, um
sich und der Welt noch einmal ihre Erfolgsfähigkeit zu beweisen. Auf der an die Grenzen der Belastbarkeit führenden Wanderung trifft sie auf den etwa gleichaltrigen Rainer mit seiner Tochter – und
besonders diese kommt ihr von Anfang an vertraut vor. Als sie sich über ihre Gefühle für Rainer klar wird, begreift sie, dass seine Geschichte ihre eigene ist. Es sind die dunklen Schatten ihrer
Biographie, die mit Rainer und dessen Tochter verbunden sind seit jenen Tagen des "Deutschen Herbstes". Und so wird die Tour durch die nepalesische Bergwelt auch zu einer Abrechnung Annes mit ihrer
Vergangenheit.
Mit "Der Pass" hat Renate Klöppel, die in Schwenningen und Freiburg lebende Autorin, nach dem Krimi "Der Mäusemörder" ihren ersten literarischen Roman vorgelegt. Ihr
gelingt das Kunststück, den spannenden Reisebericht von einer nicht alltäglichen Tour auf das "Dach der Welt" mit einer Bestandsaufnahme der Befindlichkeit einer Mitläuferin im "Deutschen Herbst" zu
verknüpfen – auf anregende, nie langatmige Weise. Gerade die auch tageszeitlich getrennte Behandlung zweier Ebenen macht einen Teil des Reizes aus: Am Tag die Schilderung der Wanderung, bei Nacht in
Wachträumen und schlaflosen Stunden die Retrospektive. Wie, so die Frage der Protagonistin und damit die des Buchs, kann man einer Schuld entrinnen, die man in jungen Jahren aus Verblendung, aus
Begeisterungsfähigkeit, aus Zuneigung auf sich geladen hat? Rechtfertigt der Wille zu einer Veränderung der Gesellschaft zerstörerische Gewalt? Wie verschmerzt man den Tod eines geliebten Menschen,
den man mitverschuldet hat? Fragen wie diese wirft Renate Klöppel in erfrischender Deutlichkeit und in klarer, unprätentiöser Sprache auf. Ihr Thema ist die Bewertung der 68er-Bewegung ihrer Folgen.
Bemerkenswert ist, wie plastisch und schlüssig Klöppel die fast. autobiographisch anmutende Schilderung des "Hineinrutschens" in das Terroristenumfeld gelingt. Sie zeigt, dass der Weg von der Idee
bis zum Einsatz von Gewalt nicht immer weit sein muss – und dass Gewalt unkontrollierbar auf einen selbst zurückfallen kann. Die Idee der Autorin, die Bergbesteigung als Metapher für die zehrende
Beschäftigung mit der innerlich zu einem Berg angewachsenen unbewältigten Vergangenheit zu nutzen, ist brillant. Je höher hinauf Anne steigt und je tiefer sie in ihre eigene Geschichte vordringt,
desto dünner wird die Luft. Anne wird Meter vor dem Ziel höhenkrank und muss absteigen. Nicht nur der knappe Sauerstoff, auch die Vergangenheit hat sie schwindeln gemacht. "Es war meine eigene
Vergangenheit, die sich mir in den Weg stellte. Sie war schwerer zu Überwinden als die Berge", heißt es an einer Stelle. Trotzdem kann "Der Pass" auch als Ermutigung gelesen werden, sich der
Erinnerung zu stellen. Die Vergangenheit ist nicht retuschierbar; doch wie formuliert es Anne am Ende: "Vielleicht bin ich eine andere geworden."
Oliver Georgi
Badische Zeitung, Freiburg, 11.5.2002